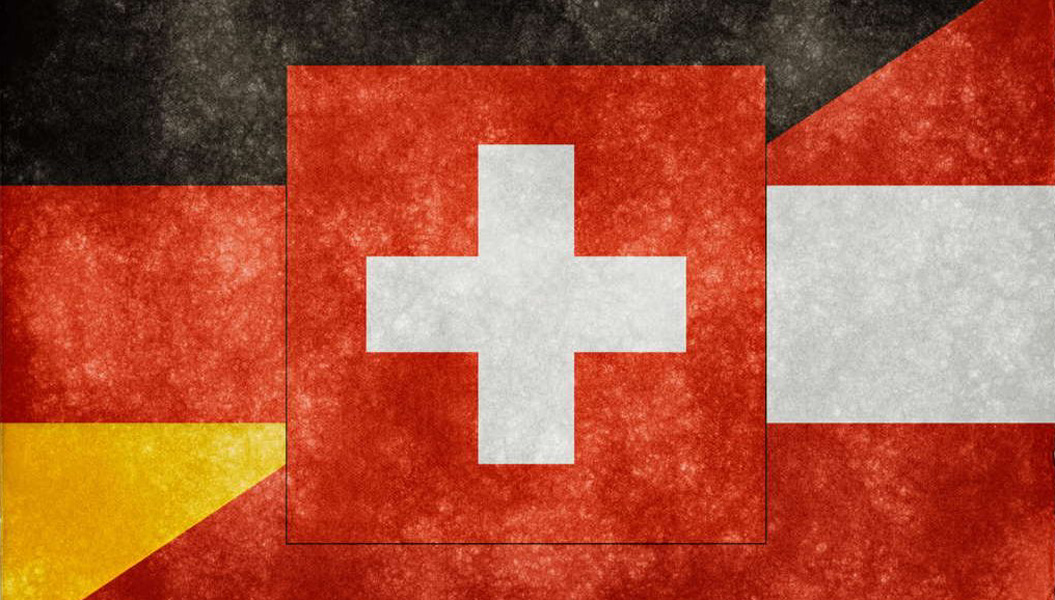Zuletzt aktualisiert 15. September 2025
Die deutsche Sprache ist ein zentraler Bestandteil der deutschen Kultur. Sprache ist nicht nur Kommunikationsmittel, sondern auch Träger von Identität, Geschichte und kollektiven Erfahrungen. Wenn die Sprache sich in eine Richtung verändert, die Klarheit, Genauigkeit und Ursprünglichkeit verliert, wirkt sich das unweigerlich auf Kultur und Gesellschaft aus. Es stellt sich die Frage, ob manche dieser Veränderungen zufällig sind oder ob sie bewusst als Instrument eingesetzt werden, um bestimmte politische Haltungen zu transportieren oder zu festigen.
Verhunzungen im Alltagsgebrauch
Ein besonders auffälliges Beispiel ist das Wort „ganz“. Ursprünglich bedeutet es „vollständig, unversehrt, heil“ – das Gegenteil von „kaputt“ oder „zerstört“. Heute wird es im Alltag inflationär als Verstärkungsformel benutzt: „ganz toll“, „ganz anders“, „ganz viel“. In dieser Übernutzung wird die ursprüngliche Bedeutung ausgehöhlt. Manchmal entstehen groteske Wortgebilde wie die Aussage eines Sportreporters während eines Radrennens: „Ganz viel mehr Stürze weniger.“ Die sprachliche Logik wird auf den Kopf gestellt.
Ein weiteres Beispiel ist der Begriff „nachhaltig“. Ursprünglich stammt er aus der Forstwirtschaft und bezeichnete die Praxis, nur so viel Holz zu schlagen, wie auch nachwachsen konnte. Heute wird er als politisches Schlagwort für nahezu jede Maßnahme verwendet, unabhängig davon, ob sie tatsächlich eine langfristige Tragfähigkeit besitzt. Damit verliert der Begriff seine präzise Bedeutung und wird zum ideologischen Schlagwort.
Auch der Ausdruck „Herausforderung“ ist ein solches Modewort. An die Stelle klarer Begriffe wie „Probleme“, „Schwierigkeiten“ oder „Krisen“ tritt eine weich gespülte Formulierung, die dramatische Sachverhalte verharmlost. Wenn man nicht mehr von „gewaltigen Problemen“ spricht, sondern von „Herausforderungen“, wird die Dringlichkeit verschleiert.
Die Rolle der Medien
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk und das Fernsehen tragen eine besondere Verantwortung. Ihrem Bildungsauftrag nach sollten sie sprachliche Qualität fördern und ein gutes Deutsch pflegen. Doch das Gegenteil geschieht: In Filmen, Serien und sogar in Nachrichtensendungen werden sprachliche Fehler und Lautverschiebungen verbreitet. Aus „Häfen“ wird „Hefen“, aus „Ferien“ werden „Färien“, aus „Städten“ werden „Steten“. Mit der Verwendung dieser als Slang zu bezeichnenden Umgangssprache trägt man dazu bei, dass sich fehlerhafte Ausdrucksweisen dauerhaft verfestigen.
Sprache, Kultur und Nation
Die deutsche Sprache ist ein wesentliches Element dessen, was Deutschland ausmacht – neben Land, Geschichte und Menschen. Wird die Sprache beschädigt, verändert oder sogar zerstört, geht ein Kern der Kultur verloren. Und mit der Kultur auch das Selbstverständnis einer Nation, die sich über Jahrhunderte, sogar Jahrtausende entwickelt hat. Wer die Sprache schwächt, schwächt unweigerlich auch das kulturelle Fundament des Landes.
Politische Dimensionen der Sprachskepsis
Dass diese Entwicklung nicht zufällig sein könnte, zeigen politische Äußerungen führender Repräsentanten. Robert Habeck, früherer Wirtschafts- und Umweltminister erklärte: „Mit Deutschland, mit Vaterlandsliebe konnte ich noch nie etwas anfangen. Ich fand das stets zum Kotzen.“ Eine Aussage, die tiefes Unbehagen gegenüber nationaler Identität ausdrückt.
Im ARD-Sommerinterview vom August 2025 wurde der grüne Politiker Felix Banaszak auf Habecks Zitat angesprochen. Anstatt sich klar zu distanzieren, wich er aus: Er liebe seine Frau, seine Tochter und Duisburg – zur Vaterlandsliebe jedoch äußerte er sich nicht direkt. Damit übernahm er zwar nicht Habecks Formulierung, verweigerte aber ebenso den Widerspruch. Diese Haltung verdeutlicht, dass die Skepsis gegenüber Begriffen wie Patriotismus und Vaterlandsliebe in Teilen der politischen Elite geteilt wird.
Debatte um die Nationalhymne
In die gleiche Richtung weist die Forderung von Bodo Ramelow, ehemaliger Ministerpräsident von Thüringen und führender Politiker der Linken, die heutige Nationalhymne abzuschaffen. Der Text der Hymne ist die dritte Strophe des „Liedes der Deutschen“, 1841 von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben verfasst. Sie ist eine poetische Liebeserklärung an Land und Nation. Anstatt diese kulturelle Tradition zu bewahren, verlangen führende Politiker ihre Abschaffung – ein deutliches Signal der Entfremdung von nationaler Identität. Gerade deshalb sollte nicht nur die dritte Strophe, sondern das gesamte „Lied der Deutschen“ wieder zur Nationalhymne erhoben werden.
Migration, Sprache und kulturelle Verständigung
Parallel dazu forcieren SPD, Grüne und Linke eine Politik, die die Migration von Millionen kulturfremder Menschen nach Deutschland begünstigt. Das Ergebnis ist, dass Verständigung im Alltag zunehmend schwieriger wird. Die deutsche Sprache wird zur Randerscheinung, während gleichzeitig im Amtsgebrauch eine „leicht verständliche Sprache“ eingeführt wird, um Kommunikationsprobleme zu überbrücken. Damit wird eine zweite Sprachordnung etabliert – und die ursprüngliche deutsche Sprache abgewertet.
Einfluss auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
Umfragen zufolge bekennen sich bis zu 70-80 % der Mitarbeiter in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu grünen oder linksnahen Positionen. Damit wird auch erklärt, warum gerade dort eine bestimmte ideologische Sprachverwendung gepflegt und verbreitet wird. Die Sprachveränderungen sind also nicht nur zufällige Fehlentwicklungen, sondern eingebettet in ein politisches und kulturelles Programm.
Vergangenheitsbewältigung und kulturelle Identität
Auch wenn es notwendig und richtig ist, die zwölf Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft kritisch aufzuarbeiten, bedeutet dies nicht, dass man die Verdienste der eigenen Kultur und des eigenen Volkes unter den Scheffel stellen muss. Andere Nationen haben in ihrer Geschichte ebenfalls Schuld auf sich geladen, doch kaum ein Land geht so weit wie Deutschland, die eigene Geschichte derart einseitig in den Mittelpunkt zu stellen und gleichzeitig patriotische Gefühle oder die Liebe zum eigenen Land zu leugnen. Gerade in Teilen der deutschen Eliten zeigt sich eine Haltung, die nationale Identität nicht bewahrt, sondern in Frage stellt. Diese Entwicklung schwächt jedoch die kulturelle Selbstachtung und die Fähigkeit, in einer globalisierten Welt selbstbewusst zu bestehen.
Sprache und Identität
Die beschriebenen Tendenzen – von der alltäglichen Sprachverhunzung über den Missbrauch von Begriffen bis hin zur politischen Relativierung von Vaterlandsliebe und Hymne – sind keine isolierten Erscheinungen. Sie fügen sich zu einem Gesamtbild, das den Eindruck erweckt, dass Sprache gezielt entkernt und umgedeutet wird, um kulturelle Bindungen zu lockern und nationale Identität zu schwächen. Wer die Sprache zerstört, zerstört Kultur. Und wer Kultur zerstört, verändert das Land in seinen Grundfesten.
Quellen & Leseempfehlungen
- Eisenberg, Peter: Das Wort und seine Bedeutung. München 2013.
- Humboldt, Wilhelm von: Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues. 1836.
- Habeck, Robert: Patriotismus – ein linkes Plädoyer. Hamburg 2010.
- Hoffmann von Fallersleben: Das Lied der Deutschen. 1841.
- Kepplinger, Hans Mathias: Publizistik und Demokratie. Wiesbaden 2018.