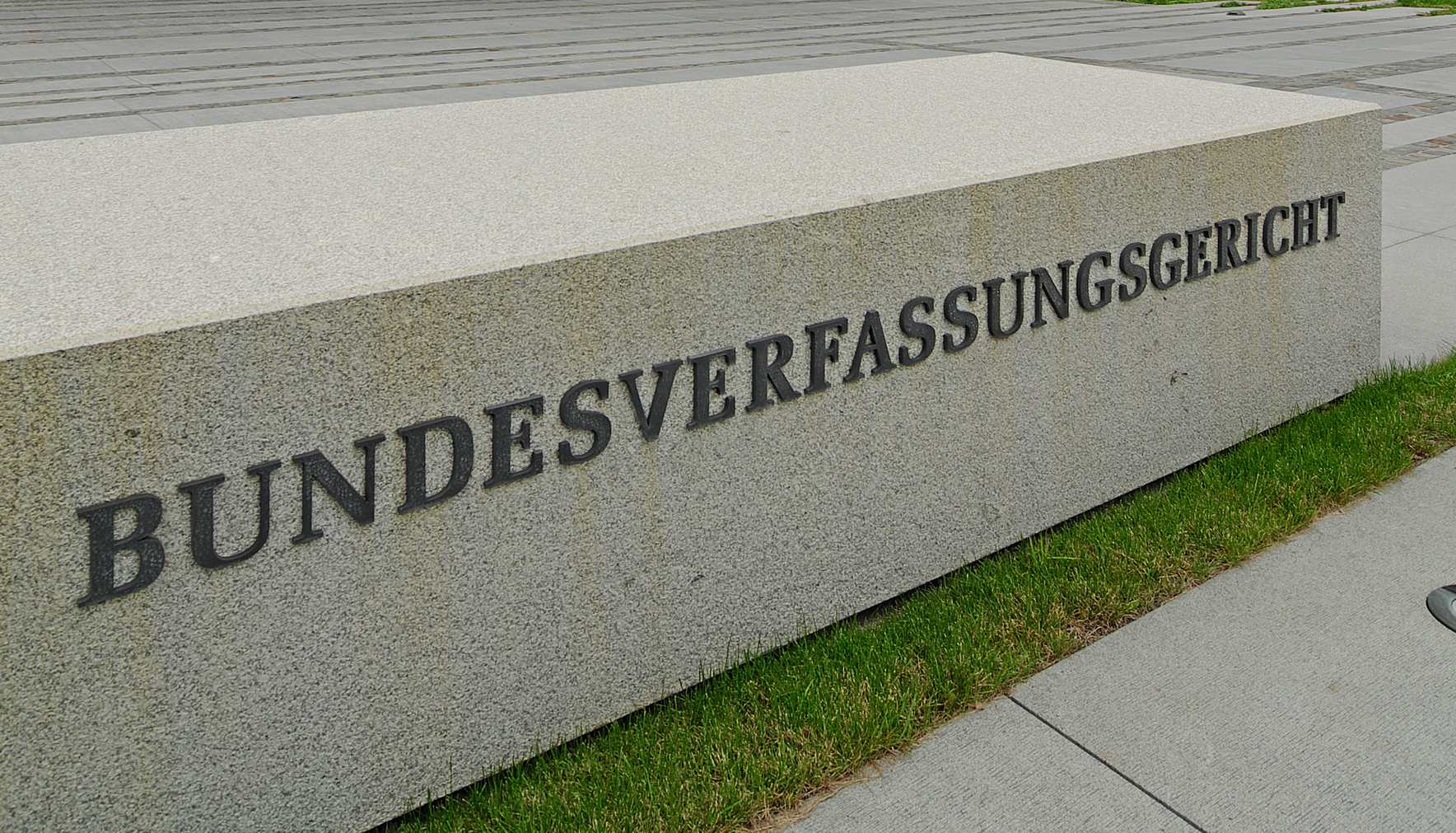Zuletzt aktualisiert 30. Juli 2025
Am Bundesverfassungsgericht werden drei Richterposten neu besetzt – und die SPD beansprucht das Vorschlagsrecht für zwei Kandidaturen. Doch dieser Anspruch ist politisch fragwürdig, juristisch nicht haltbar und demokratisch kaum zu rechtfertigen. Besonders brisant ist dies vor dem Hintergrund der Bundestagswahl im Februar 2025, bei der die SPD nur noch 16,4 % der Zweitstimmen erhielt. In einer Situation, in der die Partei nicht einmal mehr ein Fünftel der Wähler repräsentiert, erscheint es als anmaßend, gleich zwei Richter am höchsten deutschen Gericht bestimmen zu wollen.
Die Ausgangslage: Drei freie Richterposten und ein überholtes Selbstverständnis
Drei Positionen im Ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts werden vakant. Die SPD meldet Anspruch auf zwei Vorschläge an und beruft sich auf eine politische Tradition, wonach die Regierungsfraktionen das Vorschlagsrecht ausüben – gestützt auf interne Koalitionsabsprachen. Doch dieser Anspruch stammt aus einer anderen Zeit: als die SPD stärkste Bundestagsfraktion war. Nach der Wahl im Februar 2025 ist sie mit 16,4 % der Stimmen auf den dritten Platz zurückgefallen – hinter CDU/CSU (28,5 %) und AfD (20,8 %). Das alte Selbstverständnis der SPD, im Zentrum der Macht zu stehen, widerspricht damit klar der aktuellen demokratischen Realität.
Kein verfassungsrechtlich gesichertes Vorschlagsrecht
Weder das Grundgesetz noch das Bundesverfassungsgerichtsgesetz geben einer bestimmten Partei ein Vorschlagsrecht für Richterstellen. Die Ernennung erfolgt zur Hälfte durch Bundestag und Bundesrat – jeweils mit Zweidrittelmehrheit, also im Sinne eines überparteilichen Konsenses. Dass sich Fraktionen „traditionell“ abwechseln oder Vorschläge untereinander aufteilen, ist politische Praxis, aber kein Recht. Besonders problematisch wird es, wenn diese Praxis dazu führt, dass das demokratische Kräfteverhältnis verzerrt wird.
Hinzu kommt, dass das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung klargestellt hat, dass parlamentarische Gewohnheitsrechte, selbst wenn sie über Jahrzehnte praktiziert wurden, keine bindende Wirkung entfalten. Maßgeblich ist stets die aktuelle parlamentarische Mehrheit, nicht die Fortführung alter parteipolitischer Absprachen. Wer sich also auf Traditionen beruft, ignoriert die verfassungsrechtliche Realität: Es gibt keine Besitzstände im Verfassungsrecht, sondern nur den Willen der demokratisch gewählten Mehrheit.
Wenn Richter „eigene“ Richter werden – ein gefährliches Selbstverständnis
Besonders irritierend ist in diesem Zusammenhang das Auftreten von Lars Klingbeil, dem Parteivorsitzenden der SPD. Er beharrt öffentlich darauf, dass es sich um „die Kandidatinnen der SPD“ handle – und dass die Partei an diesen Vorschlägen festhalte. Doch allein die Formulierung legt bereits offen, wie wenig Verständnis für die institutionelle Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts vorhanden ist. Wer von „seinen“ Richterinnen spricht, macht deutlich, dass es nicht um neutrale Persönlichkeiten geht, die in rechtlicher Unparteilichkeit urteilen sollen, sondern um Kandidatinnen, die eine bestimmte gesellschaftliche Agenda mittragen und umsetzen sollen.
Damit verlässt Klingbeil den Boden rechtsstaatlicher Neutralität und untergräbt das Prinzip der Gewaltenteilung. Verfassungsrichter sollen nicht im Interesse einer Partei handeln, sondern über den Parteien stehen. Der Anspruch auf zwei „eigene“ Posten beschädigt nicht nur das Vertrauen in die Auswahlverfahren, sondern auch die Integrität des Gerichts selbst.
Demokratische Repräsentanz statt parteipolitische Selbstbedienung
Die SPD vertritt derzeit nur noch 16,4 % der Wählerinnen und Wähler. Ihr Anspruch auf zwei Richterposten steht deshalb in einem deutlichen Missverhältnis zur politischen Wirklichkeit im Bundestag und im Land. Die AfD ist mit über 20 % zweitstärkste Kraft, die Union fast doppelt so stark wie die SPD. Diese Kräfteverhältnisse dürfen bei der Auswahl der Verfassungsrichter nicht ignoriert werden, wenn demokratische Legitimation ernst genommen wird.
Das Bundesverfassungsgericht lebt von seiner überparteilichen Integrität. Wird seine Besetzung parteipolitisch verzerrt, droht ein Legitimationsverlust. Wer Verfassungsrichter auswählt, darf sich nicht auf Machtansprüche aus der Vergangenheit berufen, sondern muss die aktuelle politische Realität respektieren.
Kollektivistische Ausrichtung der SPD-Kandidatinnen
Bei der Bewertung der Kandidatinnen der SPD zeigt sich eine Ausrichtung, die stärker auf kollektive Werte und gemeinschaftliche Steuerung setzt. Dies bedeutet, dass das Wohl der Gemeinschaft, gesellschaftliche Rahmenbedingungen und eine gemeinsame Verantwortung im Vordergrund stehen – häufig auch verbunden mit einer stärkeren Rolle des Staates bei der Steuerung individueller Lebensverhältnisse.
Demgegenüber steht eine individualistische Perspektive, die besonders die Rechte und Freiheiten des Einzelnen betont – und staatliche Einflussnahme auf die Lebensführung des Bürgers auf das Notwendige beschränken möchte. Es zeigt sich somit, dass die Auswahl der Kandidatinnen keine rein juristische Frage ist, sondern auch eine Frage der weltanschaulichen Ausrichtung.
Es kann daher nicht überraschen, dass sich die Ideologie der beiden vorgeschlagenen Kandidatinnen mit der gesellschaftspolitischen Haltung der SPD weitgehend deckt. Umso wichtiger ist es, dass diese Nähe transparent benannt und kritisch reflektiert wird.
Bewundernswerter Widerstand aus den Reihen der CDU/CSU
Eine bedeutende Entwicklung in dieser Debatte ist, dass sich eine erhebliche Zahl von CDU/CSU-Abgeordneten – etwa 50 bis 60 – gegen die Wahl einer oder beider SPD-Kandidatinnen gestellt hat. Dieser Widerstand zeigt, dass vielen von ihnen bewusst ist, dass mit der Besetzung der Richterstellen eine gesellschaftliche Weichenstellung verbunden ist, die sie kritisch sehen.
Der Mut dieser Abgeordneten verdient Anerkennung, da sie sich gegen den politischen Mainstream und den parteipolitischen Erwartungsdruck stellen. Sie haben erkannt, dass die Besetzung des Verfassungsgerichts mit Personen, die eng mit einer bestimmten politischen Ideologie verbunden sind, langfristig das Vertrauen in die Neutralität der Institution beschädigen kann.
Fazit
Der Anspruch der SPD auf zwei Richtervorschläge basiert auf einem politischen Selbstverständnis, das nicht mehr durch demokratische Mehrheiten gedeckt ist. Wer wie Lars Klingbeil von „eigenen“ Richterinnen spricht, offenbart ein Denken, das mit der institutionellen Neutralität des Bundesverfassungsgerichts nicht vereinbar ist. Ein Vorschlagsrecht ohne aktuelle Legitimation ist kein Recht, sondern eine Anmaßung. Die Berufung auf politische Traditionen darf nicht dazu führen, den demokratischen Willen zu verfälschen. Wer das Bundesverfassungsgericht ernst nimmt, muss parteipolitische Ansprüche hinterfragen – und Richter im Sinne der überparteilichen Verantwortung auswählen, nicht im Interesse vergangener Machtverhältnisse.