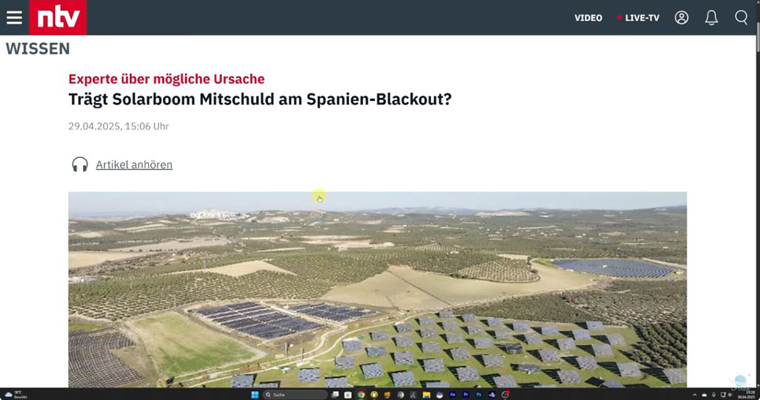Zuletzt aktualisiert 1. Mai 2025
Nach dem Zusammenbruch des Stromnetzes in Spanien und Portugal war die Verlegenheit bei den Verantwortlichen des Debakels groß. Ein möglicher Sabotageakt wäre eine schöne Ausrede gewesen. Oder „atmosphärische Störungen“. Dumm nur, dass es am Schadenstag keinen Sonnensturm gab, der für das Unglück im Süden Europas hätte verantwortlich gemacht werden können.
Die Sonne war nur indirekt für den Blackout verantwortlich, und zwar auf dem Umweg über die in Spanien zahlreichen Solaranlagen.
Aber der Reihe nach.
Ein jedes Stromnetz weltweit muss im Gleichgewicht sein: Der Netzbetreiber hat ständig genau so viel Strom einzuspeisen, wie verbraucht wird. In Europa ist eine Netzfrequenz von 50 Hertz vorgegeben. Steigt sie über 50,2 Hertz, dann gehen viele Abnehmer automatisch vom Netz, weil die Geräte, die den Strom verbrauchen, ansonsten durchbrennen würden. Nach unten endet der Normalbetrieb des Stromnetzes bei 49,8 Hertz, wobei aber gilt, dass zu wenig Strom im Netz nur regional schadet, weil der Strom räumlich begrenzt abgeschaltet werden muss, während zu viel Strom direkt in ein flächendeckendes Debakel einmünden kann – wie am 28. April auf der iberischen Halbinsel.
Denn an diesem Tag schien die Sonne heftig. Solaranlagen lassen sich – anders als konventionelle Kraftwerke – nicht per Knopfdruck herunterregeln. Die spanische Netzfrequenz bewegte sich in Richtung 50,2 Hertz, und deshalb versuchte der Netzbetreiber Red Eléctrica de España, seinen Stromüberschuss nach Frankreich abzuleiten.
Das misslang. Noch steht nicht fest, warum. Möglicherweise war ein Waldbrand in Frankreich dafür verantwortlich, der die dortigen Stromleitungen beschädigt haben könnte. Vielleicht überschritt aber auch der Energieabfluss schlicht die Kapazitätsgrenze der Stromleitungen. Nachdem die Netzfrequenz 50,2 Hertz überschritten hatte, gingen zahlreiche Abnehmer vom Netz, das kollabierte, weil durch die Notabschaltungen die Nachfrage weggebrochen war.
Red Eléctrica de España will am Montag eine offizielle Erklärung zu dem Debakel abgeben.
Droht ein ähnlicher Blackout auch in Deutschland? Die Antwort lautet: Zwar kann ein umfassender Stromausfall aus anderen Gründen nicht ausgeschlossen werden, aber eine Situation wie in Spanien ist rein regional in Deutschland zumindest derzeit ausgeschlossen.
Der Anteil der schlecht kontrollierbaren, dafür aber erneuerbaren Energien ist bei uns geringer als auf der iberischen Halbinsel. Vor allem aber kann Deutschland jederzeit (kostenpflichtig) einen Stromüberschuss nach Frankreich, in die Beneluxländer sowie nach Polen und Tschechien ableiten. Dass sämtlich Leitungen dorthin kollabieren, ist extrem unwahrscheinlich.
Höher als die Gefahr eines regionalen Stromausfalls in Deutschland ist das Risiko eines europaweiten, möglicherweise tage- oder wochenlang anhaltenden Kollaps der Stromversorgung. Denn falls beim Herunterfahren der konventionellen Kraftwerke dort, wo ein Energieüberschuss aufgenommen werden soll, ein Missgeschick geschieht – dann war es das mit Strom aus der Steckdose in Europa.
Der Blackout in Spanien lehrt uns, dass die Nutzung erneuerbarer Energien ohne hinreichende Möglichkeiten der Zwischenspeicherung, die Energieverluste mit sich bringen, Risiken birgt. Das hört der Politikbetrieb nicht gerne, und deshalb berichten die deutschen Massenmedien nur lückenhaft über die Ursachen der aktuellen Ereignisse im Süden Europas.